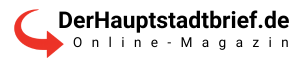Als Jorge Bergoglio 2013 auf dem Balkon des Petersdoms mit einem schlichten „Guten Abend“ grüßte, war die Welt bewegt. Der Name „Franziskus“ war Programm: Demütig, volksnah, reformbereit. Er verzichtete auf Prunk, zog in ein Gästehaus statt in den Papstpalast, fuhr Fiat statt Limousine. Viele hofften auf einen Wandel in der katholischen Kirche.
Doch was ist zehn Jahre später davon geblieben?
Erwartungen – und eine bittere Realität
Papst Franziskus hat neue Kardinäle aus aller Welt ernannt. Er wollte die Kirche von den Rändern her erneuern. Doch die zentralen Machtstrukturen in Rom blieben unangetastet. Gerade im Umgang mit Konfliktthemen – wie Homosexualität oder dem Priesteramt für verheiratete Männer – blieb es bei guten Worten. Taten? Fehlanzeige.
Fragen Sie sich auch: Wo ist der Mut geblieben, der einst so spürbar war?
Die deutsche Kirche im Sonderweg – mit wenig Rückhalt aus Rom
Deutschland steckt in einer tiefen Kirchenkrise:
- Hunderttausende treten jedes Jahr aus.
- Die Missbrauchsskandale sind noch immer nicht aufgearbeitet.
- Gottesdienste sind schlecht besucht.
Als Antwort entstand der „Synodale Weg“ – ein gemeinsamer Reformprozess von Bischöfen und Laien. Diskutiert wurden Fragen wie:
- Welche Rolle sollen Frauen künftig in der Kirche haben?
- Wie soll mit Homosexuellen umgegangen werden?
- Darf es Priester geben, die verheiratet sind?
In Deutschland fand dieser Dialog auf Augenhöhe statt – mit klaren Abstimmungen, festen Regeln und offenen Debatten. In Rom stieß das auf Skepsis.
Was denken Sie: Sollte Kirche nicht auch demokratisch denken, wenn sie gesellschaftlich relevant bleiben will?
Franziskus und sein Bild vom „Volk Gottes“
Der Papst beruft sich oft auf das „Volk Gottes“. Das klingt volksnah – ist aber nicht immer gemeint. Franziskus denkt dabei eher an eine spirituell geführte Gemeinschaft, nicht an Mitbestimmung im westlichen Sinn.
In Lateinamerika schützen Bischöfe arme Bevölkerungsgruppen. In Deutschland dagegen haben sich Katholiken eigene Strukturen geschaffen – mit Laienräten, Vereinen, sogar einer eigenen Laienvertretung seit 1868.
Der Papst aber traut diesen Strukturen offenbar wenig zu. Er meidet den direkten Dialog, besonders mit dem deutschen Zentralkomitee der Katholiken. Warum? Vermutlich, weil er das Modell nicht mit seinem Verständnis von Kirche vereinbaren kann.
Die große Enttäuschung
Zehn Jahre nach seiner Wahl wirkt Franziskus müde, widersprüchlich und oft überfordert. Die angekündigten Reformen sind kaum greifbar. Der globale Kulturkampf innerhalb der Kirche – etwa zu LGBTQ-Themen – spitzt sich zu. Franziskus schweigt oder laviert, statt zu führen.
Was bleibt, ist ein bitterer Eindruck: Der Papst wollte viel – aber er hat wenig verändert. Für die Kirche in Deutschland ist er mehr Hindernis als Hoffnung.